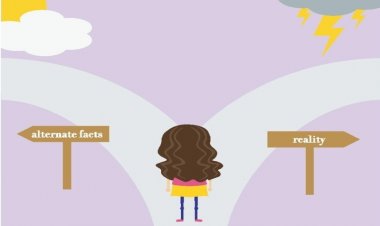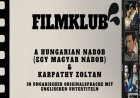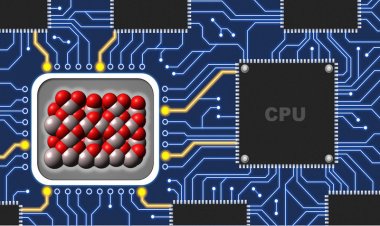Der ferne Riese und die winzigen Nachbarn

Donald Trump kann selbst seine besten Freunde überraschen. Während der am 5. November letzten Jahres zum 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten Gewählte für seine Amtseinführung und den Wiedereinzug ins Weiße Haus zu Washington rüstete, erwartete die ganze Welt eine angekündigte Überraschung: Der Spitzenreiter der „Friedenstruppe“ werde die russische Aggression beenden und die Kämpfe in der Ukraine beenden. Keiner
wusste, mit welcher listigen Lösung er einen Waffenstillstand, vielleicht gar Frieden arrangieren würde; aber seine überwältigende Propagandamaschinerie gestattete Fragezeichen nur beim Datum, nicht im Inhalt.
Tatsächlich geschah das Schlimmste, das sich die Patrioten aller Länder hätten vorstellen können: Trump drohte mit der Verhängung von Sanktionen gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin – mit ähnlichen Maßnahmen, wie sie von den rechtsgerichteten europäischen Regierungen seit dem Beginn des Krieges als unwirksam, ja sogar schädlich desavouierten! Also ist der US-Präsident vielleicht doch kein Zauberer, sondern nur ein Realpolitiker? Der ungarische Außenminister Péter Szijjártó jedenfalls stimmte nach einem Telefonat mit seinem neuen amerikanischen Amtskollegen Marco Rubio anstelle eines Vetos für die jüngsten EU-Sanktionen. „Die Europäische Kommission hat sich zum Schutz der in die EU-Mitgliedstaaten führenden Gas- und Ölpipelines verpflichtet“, schrieb Szíjjártó auf seiner Facebook-Seite. So wirkt Trumps Sanktionsdrohung jedenfalls ganz anders.
Trumps Einschätzung hängt davon ab, ob die Betrachter den politischen Erlöser, einen Macht und Gewalt ausübenden Abenteurer, einen größenwahnsinnigen Geschäftsmann oder eine instabile Persönlichkeit in der Rolle des Wahnsinnigen in ihm sehen. Eine Zwischen- oder Mischlösung ist schwer vorstellbar.
„Mit einem Federstrich machte er aus dem Golf von Mexiko den Golf von Amerika. Während des Essens kam der Appetit: Warum sollten denn nicht Grönland und sogar der Panamakanal folgen?“, schrieb in der Online-Zeitung Transtelex László László, ein siebenbürgischer Geschichtsprofessorlehrer, und fügte mit einem Wortspiel hinzu: „Trump mag auch sonst Panama-Aktionen (ungarisches Synonym für Gangstertum).“ Eine ähnliche Bewertung erhält auch „der hochgepushte Königsmacher, Elon Musk“, der „seine Maske abgeworfen und offen den Hitlergruß gezeigt hat.“ ... Es verging nicht einmal eine Woche nach dem Armschwungskandal, da tauchte er unerwartet bei einer Wahlkampfveranstaltung der deutschen Rechtsextremen auf, „wo er über die Verwässerung der deutschen Kultur sprach und davon, dass es an der Zeit wäre, die Sünden der Vergangenheit hinter sich zu lassen“. László László gab seinem Artikel den treffenden Titel: „Sarkastische
Notizen aus der Mitte des Nachrichtenlärms“.
In der Zwischenzeit machte Trump mitten im Nachrichtenlärm weiter. Neben vielen anderen Dekreten startete er auch ein Flugzeug: Er wollte illegale kolumbianische Einwanderer nach Hause bringen lassen, nur hatte er leider die Regierung in Bogota zu informieren vergessen.
Nachdem er Kolumbien mit Sanktionen überhäuft hatte, schickte der dortige Präsident sein eigenes Flugzeug, um die Migranten abzuholen...
Aber es ist schwer, Probleme rund um Migration mit Gewalt zu lösen. Die konservative Neue
Zürcher Zeitung kommentierte Trumps erste Entscheidungen so: „Die Tatsache, dass diese Maßnahmen Gesetze oder die Verfassung verletzen, stellt für Trump kein Hindernis dar – im Gegenteil: Er demonstriert damit seinen Sinn für Macht und seine Entschlossenheit. Wer aber an der längst fälligen Reform des Asylwesens interessiert sei, könne, so die NZZ, mit Trumps Maßnahmen nicht zufrieden sein. Warum? „Sie werden sehr schnell aufgehalten
durch rechtliche Probleme und die Gerichte. Aber die Migrationspolitik gehört nicht vor Gericht, sondern in den Kongress.“
Aber das politische System hat sich nicht nur in den mächtigen USA – die sich nach Trumps Willen auf Grönland, Kanada und Panama ausdehnen könnten – verändert, sondern auch im kleinen Österreich (hier ist es gerade im Umbruch).
Es ist schwer zu beschreiben, nach welchen mit Schlammschlachten verzierten Rundtänzen die Gewinner der Wahlen vom 29. September zu verhandeln begonnen haben. Herbert Kickl, der Vorsitzende der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ), wird mit großer Sicherheit Bundeskanzler und Christian Stocker, der neue Chef der Österreichischen Volkspartei (ÖVP), sein Vize. Offiziell ist nicht bekannt, wie weit die Koalitionsgespräche gediehen sind,
aber eines ist sicher: Bei bestimmten Themen wird es sehr schwierig sein, zu verhandeln, zum Beispiel über das europäische Luftabwehrsystem Sky Shield.
In diesem Zusammenhang besonder spannend ist ein Interview, das Balázs Orbán der politische Direktor des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán, einem österreichischen Meidum gegeben hat. Nach den üblichen schönen Sätzen über die Zusammenarbeit fragte ihn der Pragmaticus-Journalist nach, wie der Auftrag zur Regierungsbildung an Kickl die Beziehungen zwischen den beiden Ländern verändern könnte. Laut Balázs Orbán ähneln die Sorgen der FPÖ im Zusammenhang mit „den globalistischen und liberalen Interessen in Brüssel und im Westen“ jenen, die auch die ungarische Regierung hege. „Wir haben viele gemeinsame Probleme, denn
Brüssel versucht gleichermaßen die ungarischen wie die österreichischen nationalen Interessen zu untergraben, also müßten wir aktiv zusammenarbeiten, um unsere Gesellschaften zu schützen.“
In der Zwischenzeit können sie auch angreifen. Mit Kickl – neben Orbán und dem Slowaken Robert Fico – werden bald drei Regierungschefs bei den EU-Gipfeln anwesend sein, die
„Nachsicht gegenüber Aggressor Putin an den Tag legen und sich deutlich zurückhalten gegenüber der Ukraine“, schrieb die konservative deutsche Tageszeitung Die Welt. Autor Dirk Schümer hält es für möglich, dass bei den Oktober-Wahlen in der Tschechischen Republik Andrej Babiš gewinnt – dann würden vier solche „patriotische“ Parteien in Mittel- und Osteuropa regieren.
Mindestens zwei Fragen bleiben unbeantwortet. Erstens: Wie wird die EU-feindliche FPÖ mit der pro-europäischen ÖVP kooperieren? Und zweitens: Was tun die kleinen mitteleuropäischen Nachbarn wie Österreich, Slowakei, Tschechien und Ungarn, wenn die patriotischen Interessen der riesigen Vereinigten Staaten nicht mit ihren vereinbar sind?
Peter Martos